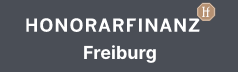Nachhaltiges Investieren ist eines der Schlagworte unserer Zeit. Kaum ein Thema wird in der Finanzwelt so kontrovers diskutiert wie ESG-Investments. Doch wie ehrlich ist das Versprechen von Nachhaltigkeit wirklich? In der neuen Folge der Kapitalgespräche sprechen Klaus und Julian über Chancen, Grenzen und Kritikpunkte des sogenannten ESG-Investings und darüber, ob es sich dabei um echten Fortschritt oder nur ein gutes Gewissen in ETF-Form und Greenwashing handelt.
Für alle, die lieber hören, statt lesen; der Video-Podcast auf YouTube und Spotify.
Was bedeutet ESG überhaupt?
ESG steht für Environment, Social und Governance. Damit soll Kapital bevorzugt in Unternehmen fließen, die ökologisch verantwortungsvoll handeln, sozial stabil aufgestellt sind und eine gute Unternehmensführung besitzen. Ziel ist es, Rendite, Risiko und Verantwortung miteinander zu verbinden. ESG misst also, wie zukunftsfähig ein Unternehmen ist, nicht nur, wie gut es klingt.
Nachhaltige Geldanlage im ETF-Bereich
Gerade im Bereich der ETFs hat das Thema in den letzten zehn Jahren enorm an Bedeutung gewonnen. Anfangs galt nachhaltiges Investieren als Nischenidee, doch inzwischen gibt es zahlreiche ESG-konforme Fonds und Indizes, wie den MSCI World SRI oder den Global Clean Energy Index.
Studien von MSCI, BlackRock oder Harvard zeigen, dass ESG-Unternehmen oft stabilere Cashflows, geringere Kapitalkosten und weniger Reputationsrisiken haben. Gleichzeitig gibt es keine signifikante Über- oder Unterperformance im Vergleich zu traditionellen Indizes. ESG ist damit vor allem modernes Risikomanagement, kein Renditeverzicht.
ESG in der Praxis: Ausschlüsse und Filter
Nachhaltige Indizes schließen bestimmte Branchen konsequent aus, etwa Waffenproduktion, Tabak, Glücksspiel oder genetisch veränderte Organismen. Je strenger die ESG-Kriterien, desto weniger Unternehmen bleiben übrig.
Beim MSCI World SRI zum Beispiel werden rund 75 % der Unternehmen ausgeschlossen, nur etwa 400 der ursprünglich 1.600 Firmen bleiben im Index.
Trotzdem zeigen Vergleiche, dass sich die Performance von ESG-ETFs und Standard-Indizes langfristig nahezu parallel entwickelt. Zwischenzeitliche Unterschiede, wie die Outperformance von ESG-Fonds bis 2022, hingen stark mit der Technologielastigkeit dieser Indizes zusammen.
Kritik an ESG: Greenwashing und Intransparenz
Einer der größten Kritikpunkte am ESG-System ist die fehlende Vergleichbarkeit der Ratings. Verschiedene Ratingagenturen bewerten dasselbe Unternehmen oft völlig unterschiedlich. Eine Studie zur „Divergenz von ESG Ratings“ zeigt: Die Korrelation zwischen den Bewertungen ist gering.
Das führt zu Intransparenz und Willkür, manche Unternehmen können so durch geschickte Darstellung ein besseres Rating erhalten, obwohl sie faktisch kaum nachhaltiger wirtschaften.
Ein Beispiel für mögliches Greenwashing ist McDonald’s: Trotz steigender CO₂-Emissionen erhielt das Unternehmen 2020 ein besseres ESG-Rating von MSCI. Der Grund: Emissionen aus der Lieferkette wurden einfach nicht gewichtet, weil der Klimawandel angeblich kein signifikantes Risiko für das Geschäftsmodell sei. Stattdessen floss die Umstellung von Plastik- auf Papierverpackungen positiv in das Rating ein.
Solche Fälle zeigen, dass ESG-Kriterien in der Praxis häufig unterschiedlich interpretiert und verzerrt angewendet werden, was den Verdacht von Greenwashing nährt.
Anlegerverhalten und Emotionen
Interessant ist auch die psychologische Seite: Anleger, die sich mit ihren Investments identifizieren, verkaufen in Krisen seltener. Behavioral-Finance-Daten zeigen, dass ESG-Anleger emotional stabiler agieren und damit konstantere Renditen erzielen. Nachhaltigkeit kann also auch die Anlagedisziplin stärken.
Trotz der positiven Ansätze bleiben Fragen: wie fair ist es, energieintensive Unternehmen wie Shell oder Volkswagen komplett auszuschließen, obwohl sie entscheidend zur Transformation der Wirtschaft beitragen könnten?
Und wie soll man Nachhaltigkeit messen, wenn jede Agentur andere Kriterien anlegt?
ESG ist kein Allheilmittel, aber ein Schritt in Richtung evolutionären Kapitalismus, einer Wirtschaft, die langfristig denkt und Verantwortung übernimmt.
Fazit zum Thema Greenwashing in der Geldanlage: Verantwortung ja, Ideologie nein
Nachhaltiges Investieren ist kein Schwarz-Weiß-Thema. ESG kann helfen, Risiken zu minimieren und Kapital in verantwortungsvolle Bahnen zu lenken, doch es ersetzt keine kritische Auseinandersetzung.
Ob man ESG-Filter nutzt oder nicht, bleibt eine individuelle Entscheidung. Wichtig ist, sich bewusst mit dem Thema auseinanderzusetzen.
„Wer langfristig denkt, kann Verantwortung und Rendite vereinen – rational, nicht dogmatisch.“
Häufige Fragen zum Thema Greenwashing bei der Geldanlage